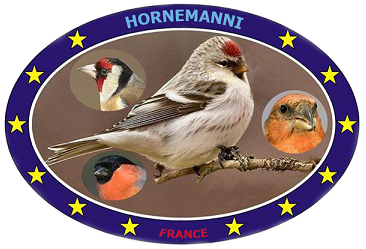Führung der Viehzucht
Die Winterperiode
Von Ende Oktober, Anfang November bis Anfang März werden die männlichen Zuchttiere von den weiblichen Zuchttieren getrennt. Die Grünfinken werden dann in geräumigen Volieren untergebracht, wo sie den ganzen Winter über bleiben werden.
Ende Oktober ist auch der beste Zeitpunkt, um die geschlossenen Ringe aus farbigem Aluminium zu bestellen. Die für Ausstellungen bestimmten Tiere sind bereits seit einem guten Monat in den Zuchtkäfigen und bereiten sich in aller Ruhe auf die großen Veranstaltungen vor. Am Ende der Ausstellungszeit werden sie nach einer Vitaminkur ebenfalls in Volieren ausgesetzt.

Beispiel für eine Outdoor-Voliere

Beispiel für eine Outdoor-Voliere

Beispiel für eine Outdoor-Voliere

Beispiel für eine Outdoor-Voliere

Beispiel für eine Zimmervoliere

Beispiel für eine Zimmervoliere
Während dieser Zeit und vor allem, wenn die Vögel in ungeheizten Räumen untergebracht sind, ist es ratsam, ein stärker angereichertes Futter als üblich zu verfüttern.
Um die Körnermischung zu ergänzen, können regelmäßig kleine schwarze Sonnenblumen und Rispenhirse gefüttert werden. Einmal pro Woche wird den Vögeln ein Trockenfutter zur Verfügung gestellt, das mit morbiden Perlen, Vitaminen und Spurenelementen angereichert ist. Im Winter ist es kein Problem, die morbiden Perlen mit dem Aufzuchtfutter zu vermischen und aufzubewahren. Bei gutem Wetter können Obst oder bestimmte Gräser in kleinen Dosen verfüttert werden. Je nach Wetterlage und in den letzten Jahren aufgrund der globalen Erwärmung ist es nicht ungewöhnlich, einige Pflanzen zu finden, die den ganzen Winter über gefüttert werden können. Ab Ende Februar findet man im Südwesten sogar weiße Vogelmiere und Löwenzahn.
Im Februar wird eine fünftägige Kur mit einem Antikokzidium empfohlen. Auf dem Markt sind zahlreiche Produkte erhältlich, die meisten sind verschreibungspflichtig.
Die Verwendung von natürlichen Produkten ist ebenfalls möglich, hat aber keinen Einfluss auf die Kokzidien. Man kann unpasteurisierten Bio-Apfelessig verwenden. Die Dosierung beträgt 1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser über 5 Tage.
In der kalten Jahreszeit ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Glukosebasis besonders empfehlenswert.
Grit, Trockenknochen sind in den Volieren immer vorhanden.
Die Luftfeuchtigkeit im Aufzuchtraum sollte besonders überwacht werden. Bei der Unterbringung in Außenvolieren sollte darauf geachtet werden, dass die Vögel einen wind- und wettergeschützten Platz haben.
Die Winterzeit fällt mit der Zeit der Großreinemachung zusammen. Je nach Anzahl der Tiere sollte man eine oder zwei Volieren zur Verfügung stellen, um die Räumlichkeiten und Einrichtungen im Turnus zu reinigen und zu desinfizieren.
Zur Behandlung äußerer Parasiten und zur Beseitigung des Räuderisikos empfiehlt es sich, zwei Tropfen Ivermectin in verdünnter Lösung auf die Innenseite des Flügels auf Höhe des Unterarms aufzutragen. Für die Behandlung sollte ein Tropfer oder ein Wattestäbchen verwendet werden. Achte jedoch darauf, dass du die angegebene Dosis nicht überschreitest. Eine Überdosierung führt in zwei von drei Fällen zum Tod des Vogels. Bei Räude tropfe ich die Tropfen direkt auf eines der betroffenen Beine.
Es ist auch die ideale Zeit, um die Einrichtungen zu verbessern, das Material zu waschen und zu reparieren und über die Aufstellung der Vögel für die nächste Saison nachzudenken. Es empfiehlt sich, mehrere Paarungspläne zu erstellen, z. B. Plan B oder C, da der Winter lang ist und nur Vögel in perfektem Zustand verpaart werden.
Im Februar werden die Zuchtpaare zusammengestellt. Der Züchter muss dann bei der Paarung verschiedene Parameter berücksichtigen.
Größe und Form:
Es ist wichtig, Vögel auszuwählen, die sich entweder ergänzen oder eine dem Standard entsprechende Größe und Form aufweisen. Denken Sie daran, dass ein Grünfink ein robuster Vogel ist.
Das Gefieder:
Man sollte die Struktur der Federn berücksichtigen und seine Vögel daher gut beobachten. Eine lange oder Schimmelfeder muss mit einer kurzen oder intensiven oder sogar halbintensiven Feder verpaart werden. Kanarienzüchter kennen dieses Prinzip sehr gut. Bei den europäischen Sperlingsvögeln, insbesondere den Grünfinken, ist das Konzept der Intensiv- und Schimmelfedern jedoch weit weniger bekannt.
Zwei Vögel mit langen Federn, die miteinander verpaart werden, können in ihrer Nachkommenschaft Vögel mit noch längeren Federn hervorbringen. Von Schimmel zu Schimmel führt dies zu Vögeln mit losen Federn an den Flanken, offenen Stellen an der Brust, falscher Bedeckung der Schenkel und Beine und sogar zu Lumps, wie sie bei Haltungskanarien vorkommen. Lumps sind follikuläre Zysten, die mit eingewachsenen Haaren beim Menschen vergleichbar sind. Wenn die Feder wächst, wächst sie nicht aus dem Körper des Vogels heraus, sondern bildet einen Ball unter der Haut. Diese Art von Pathologie kann zu Infektionen und schließlich zum Tod des Vogels führen. Wenn ein Grünfink follikuläre Zysten aufweist, sollte er nicht zur Zucht verwendet werden. Diese Pathologie, die bei Haltungskanarien häufig vorkommt, ist bei Grünfinken sehr selten. Vorbeugend sorgen tägliche Bäder für eine geschmeidigere Haut und fördern das Wachstum der Federn.
Farbe:
Bei ahnenfarbigen Exemplaren sollten helle und vor allem nicht stumpfe Vögel verpaart werden. Ein stumpfes Gefieder kann auch Ausdruck eines Nahrungsmangels oder eines Problems mit der allgemeinen Kondition sein. Ahnenfarbige Weibchen weisen in der Regel viel braunes Phaeomelanin auf. Die Männchen haben ein viel grüneres und helleres Gefieder. Es ist jedoch zu beachten, dass junge Männchen im ersten Jahr oft viel mehr Phaeomelanin aufweisen als erwachsene Männchen. Daher kann man je nach Wahl und Ziel entweder männliche oder weibliche Linien erstellen.
Männliche Linien werden aus weiblichen Tieren mit möglichst wenig Braun gezüchtet. Weibliche Linien werden aus sehr braunen Weibchen und schwarzbraunen Männchen gezüchtet.
Für Mutationen müssen die Vögel entsprechend den angestrebten Zielen verpaart werden. Was für die angestammten Phänotypen gilt, gilt auch für die mutierten Phänotypen und Genotypen. Sie werden in der Lage sein, Ihre männlichen und weiblichen Linien zu erstellen. Daher wird es wichtig sein, den Phänotyp und den Genotyp Ihrer Zuchttiere zu kennen und auch die Verwandtschaftsverhältnisse zu kennen. Ein Stammbaum kann sehr hilfreich sein, wenn Sie ein Merkmal fixieren möchten. Achten Sie auch auf Verpaarungen, von denen abgeraten wird. Ein nächster Artikel wird sich diesem Thema widmen.
Das Grooming :
Es wird empfohlen, den Vögeln die Nagelspitzen zu schneiden, um die Paarung zu erleichtern. Ein Männchen mit langen Fingernägeln wird Schwierigkeiten haben, das Weibchen zu befruchten. Wenn seine Fingernägel spitz sind, wird das Weibchen bei der Paarung ausweichen, wenn es die Fingernägel in ihren Rücken stößt. Ein Weibchen mit langen Fingernägeln ist auf den Sitzstangen weniger stabil und kann bei spitzen Fingernägeln die Eier während des Brütens zerkratzen.
Die Zeit der Brutvorbereitung
Es ist nun Anfang März. Die Sonne geht jeden Tag zwei Minuten früher auf und im Durchschnitt zwei Minuten später unter. Die Dimmer werden entsprechend der Dauer des Außenlichts eingestellt, wenn Sie in Innenräumen züchten.
Die Grünfinken und ihre Pfleger werden allmählich ungeduldig. Die Anlagen sind sauber. In den kleinen Volieren sind die Vögel paarweise. In den größeren Räumen werden die 4 bis 5 Grünfinkenweibchen von dem ausgewählten Männchen umworben. Die Brutzeit steht kurz bevor.
Auf den Feldern und in den Gärten sind immer mehr wilde Gräser zu finden, vor allem die weiße Vogelmiere und der Löwenzahn. Die Männchen stoßen fröhliche Triller und gedehnte, zischende Töne „chuiiiiiiii“ aus. Einige Weibchen beginnen, Federn, die sie in der Voliere gesammelt haben, oder getrocknete Zweige und feine Wurzeln zu transportieren. Es ist zu beobachten, dass die Futterstellen regelmäßig von Körnern befreit werden, um Platz für eben diese Zweige zu schaffen. Die Weibchen bereiten sich auf das Nisten vor.
Der Fehler besteht nun darin, sich zu beeilen und die Nistkästen in aller Eile anzubringen. Die Weibchen sind zwar allmählich bereit, die Männchen jedoch noch nicht. Die Männchen sind etwa drei Wochen nach den Weibchen zur Fortpflanzung bereit. Dies erklärt, warum der Züchter, wenn er es mit dem Anlegen der Nester zu eilig hat, oftmals überwiegend helle Gelege vorfindet. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass das Ausbremsen von Weibchen bei der Fortpflanzung und der Versuch, sie hinzuhalten, fehlschlagen kann und mit Gelegen in den Futtertrögen oder auf dem Volierenboden endet.
Es empfiehlt sich daher, die Vorbereitung zu verfeinern und ein Trockenfutter mit Vitamin E, Spurenelementen und Vitaminen zu füttern, das mit morbiden Perlen oder gekeimten Samen ergänzt wird. Dieses Futter wird den Grünfinken täglich verabreicht, bis das erste Ei gelegt wird.
Vitamin E darf nicht überdosiert werden, da die Vögel, vor allem die Männchen, sonst die Nester zerstören, die Weibchen am Brüten hindern, die Eier aufbrechen und sogar fressen und die Küken bei der Geburt töten.
Als Ergänzung zum Futter können reife und halbreife Gräser an die Vögel verfüttert werden. Dabei sind die Vorsichtsmaßnahmen beim Pflücken zu beachten. Ein Artikel zu diesem Thema ist in Vorbereitung.
Ich persönlich beschließe Ende März in der Regel, die Nester anzubringen. Ich hänge dann in den Volieren Holzbretter auf, an denen Metallnester befestigt sind. Thuja- oder Ginsterbüschel, die ebenfalls an den Holzträgern befestigt sind, tarnen die zukünftigen Nistplätze. Im Inneren der Metall- oder Drahtnester wird eine Hanfschale ausgelegt, die es den Vögeln ermöglicht, die Struktur ihres Nestes schneller und einfacher zusammenzusetzen.
Paarweise oder polygam aufziehen?
Ich züchte seit vielen Jahren nach beiden Methoden.
Bei der Paarhaltung in einer kleinen Voliere oder einem geräumigen Käfig muss man wachsam sein und das Verhalten des Männchens beobachten. Wenn es durch eine zu hohe Vitaminzufuhr zu aufgeregt ist, kann es das Weibchen vertreiben und das Nest zerstören, die Eier aufbrechen oder fressen und die Jungen beim Schlüpfen oder am Tag vor dem Schlüpfen töten. Glücklicherweise sind diese verschiedenen Katastrophenszenarien nicht zu verallgemeinern, und sehr oft wird sich das Männchen perfekt um sein Weibchen kümmern. Wenn Sie dennoch auf ein solches Verhalten stoßen, zögern Sie nicht, das Männchen am Tag vor dem Schlupf von seinem Weibchen zu trennen. Setzen Sie es dann in einen Ausstellungskäfig im Inneren der Voliere. So kann das Weibchen es hören und auch weiterhin sehen. Sobald das Ei gelegt ist, sollte es durch ein Dummy-Ei ersetzt und das Männchen mit dem Weibchen freigelassen werden. Wenn das fünfte Ei gelegt wird, kehrt das Männchen für die Dauer des Brütens oder länger in den Ausstellungskäfig zurück.
Bei Polygamie, d. h. einem Männchen mit 5 bis 6 Weibchen, je nach Größe der Voliere, sind die oben genannten Probleme viel seltener. Das Männchen muss sich allen Weibchen widmen und verbraucht dabei viel mehr Energie. In der Regel beginnen die Weibchen in aller Ruhe eines nach dem anderen mit dem Brüten. Wenn ein Männchen jedoch anfängt, die Nester zu zerstören oder die Eier zu fressen, ist es sinnlos, darauf zu bestehen, und es ist besser, das Männchen zu ersetzen und aus der Zucht zu streichen.
Vermeiden Sie es auch, ein Trio zu bilden. In diesem Fall kann es passieren, dass man die Weibchen bei der Paarung beobachtet und das Männchen außen vor lässt. Noch schlimmer ist es, wenn das Weibchen oder das Männchen seine Zeit damit verbringt, das andere Weibchen zu vertreiben.
Die Zeit der Aufzucht
Es ist Ende März und die Grünfinken sind in Bestform. Die Männchen singen und jagen die Weibchen. Letztere tragen in ihren Schnäbeln das kleinste Material mit sich herum, um mit dem Nisten zu beginnen. Jetzt ist es an der Zeit, die Nester aufzuhängen. Das künstliche und natürliche Licht wird von Tag zu Tag länger. Im Durchschnitt zwei Minuten am Morgen und ein bis zwei Minuten am Abend. Wenn die Temperatur mindestens 13 bis 14 Grad beträgt und die Lichtdauer 14 bis 15 Stunden beträgt. Die Bedingungen für die Fortpflanzung sind ideal.
Sobald sie sich auf der Unterlage positioniert haben, ist es nicht ungewöhnlich, das Männchen von einem Nest zum anderen gehen zu sehen. Manche legen sogar ein Gras oder eine Feder ab, als wollten sie die endgültige Wahl des Standortes markieren.
Erfahrungsgemäß ist es üblich, dass die Nester im Laufe des Tages gebaut werden. Wenn Sie sich für eine bepflanzte Voliere entschieden haben oder Ginster- oder Thujabündel in den Volieren platzieren, werden Sie zweifellos das Glück haben, den Bau eines echten natürlichen Nestes ohne künstliche Unterstützung zu beobachten. Dies beweist, dass der Grünfink trotz jahrzehntelanger Zucht in Gefangenschaft noch immer seine arteigenen Reflexe besitzt.
Bei Nestern mit Nisthilfen habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, einen Hanfschnitt aus der Kanarienvogelzucht auszulegen, um dem Weibchen bei der Befestigung des Nistmaterials zu helfen. Die Basis des Nestes besteht in der Regel aus Kokosfasern, Gräsern, Wurzeln und Moos, um dann mit weicheren Materialien wie Ziegenhaar, Kaninchenhaar, Baumwolle (100% natürlich) und Weidenbaumwolle ausgekleidet zu werden. Das Weibchen ist sehr eifrig beim Bau ihres Nestes. Oft baut es es, zerstört es, baut es wieder auf, zerstört es, baut es wieder auf, wechselt den Standort und beendet es schließlich an einem der bereits besuchten Orte. Manchmal beschließen die Männchen, den Nestbau zu überdenken und werfen das vom Weibchen angesammelte Material weg. Junge Weibchen haben mehr Schwierigkeiten beim Bau ihres ersten Nests. Sie müssen sich daher mit Geduld wappnen.
Sobald das Nest fertiggestellt ist, lässt die Ablage des ersten Eies nicht lange auf sich warten. Dies ist ein besonders sensibler Zeitraum, in dem der Züchter seine Beobachtungsgabe unter Beweis stellen muss, insbesondere bei jungen Weibchen. Man kann die Eiablage voraussehen, indem man den Bauch der Grünfinkenweibchen und ihr Verhalten beobachtet. Einige bleiben auf einer Sitzstange oder einem Ast sitzen, andere bleiben bereits im Nest, als hätten sie mit dem Brüten begonnen. Je nach Wetter und vor allem Temperatur ist es ratsam, zur Zeit der Eiablage am Morgen anwesend zu sein. Wenn das erste Ei gelegt wird, stelle ich die Verteilung des angereicherten Futters ein.

Die Eier können jeden Tag entfernt und durch künstliche Eier ersetzt werden. Sie müssen jedoch auf ein Bett aus Alpaka gelegt und mehrmals täglich gewendet werden.

Parenthese zur Legekrankheit
Das größte Risiko ist die Legekrankheit. Diese wird am Morgen diagnostiziert. Das Weibchen ist dann aufgebläht, sitzt auf ihrer Sitzstange oder sogar auf dem Boden, hat manchmal die Flügel hängen lassen und die Augen halb geschlossen. Es besteht eine Gefahr! Man kann diese Symptome auch am Tag vor der Eiablage beobachten, was noch schlimmer ist. Die Wehen sind im Gange, verlaufen aber schlecht. Da das Weibchen das Ei nicht abtransportieren kann, erschöpft es sich und wenn der Züchter nicht schnell eingreift, stirbt es. Wenn man am Vortag bemerkt, dass das Weibchen leidet, sollte man es in einen Krankenhauskäfig oder einen Ausstellungskäfig in der Nähe einer Wärmequelle setzen. Der Boden des Käfigs ist mit Schaumstoff ausgelegt, um den Fall des Eis abzufedern, falls sie es schließlich auf natürlichem Wege ausscheidet. Eine einzige Sitzstange ist ausreichend, die möglichst niedrig ist. Verteilen Sie Wasser mit einer Mischung auf Glukosebasis, um eine stimulierende Wirkung zu erzielen. Wenn nötig, geben Sie die flüssige Zusammensetzung direkt in den Schnabel des Vogels. Die durch die Aufnahme der Glukose erzeugte Energie wird zusammen mit der Wärme dafür sorgen, dass das Grünfinkenweibchen wieder zu Kräften kommt und, wenn alles nach Plan verläuft, auch wieder normal Eier legen kann.
Wenn der Züchter die Legekrankheit zu spät bemerkt, d. h. am Morgen, da Grünfinken zwischen 8.00 und 8.30 Uhr legen, muss die Eiablage provoziert werden. Dieser Eingriff ist nicht ohne Risiko. Zunächst muss der Vogel so sanft wie möglich gegriffen werden, damit der Bauch des Weibchens nicht gequetscht wird. Sobald Sie den Vogel in der Hand haben, sind verschiedene Techniken möglich.
Das vorrangige Ziel ist die Rettung des Weibchens, daher ist es egal, ob das Ei nach der Evakuierung zerbricht. Die häufigste Technik ist die des Topfes mit kochendem Wasser. Setzen Sie den Vogel über einen Topf mit kochendem Wasser, das Wasserdampf abgibt. Testen Sie vorher mit der Hand die Hitze des Dampfes, um den Vogel nicht zu verbrennen. Halten Sie den Vogel also in sicherer Entfernung, so dass sein Bauch dem Dampf ausgesetzt ist, der aus dem Topf aufsteigt. Diese Wärme- und Feuchtigkeitsquelle wird dazu beitragen, dass sich die Kloake ausdehnt. Wenn der Bauch erwärmt ist, geben Sie mit einer Pipette ein bis zwei Tropfen Olivenöl hinein. Sie können auch ein in Olivenöl getauchtes Wattestäbchen verwenden. Mit dem Wattestäbchen kann man auch sanft den Bauch des Weibchens massieren, wobei man darauf achtet, nicht zu drücken und immer in die gleiche Richtung, zur Kloake hin, zu gehen. Nach der Behandlung lassen Sie das Weibchen im Ausstellungskäfig oder im Krankenhauskäfig und halten Sie die Temperatur bei 28-30 °C. Stellen Sie den Käfig an einen ruhigen Ort. Es ist logisch, dass der Vogel das Ei nach einigen Minuten ausscheidet.
Wenn das Ei beim Hantieren mit dem Ei im Bauch des Weibchens zerbricht und sie es nicht herausnehmen kann, ist der Käfig verloren.
Es kommt auch vor, dass einige Weibchen das Ei, das an ihrem Eileiter klebt, ausscheiden. Auch in diesem Fall sind die Überlebenschancen des Vogels gleich null.
Die Legekrankheit kommt bei allen Vogelarten vor. Bei Grünfinken kommt sie nicht häufig vor, aber man sollte sich ihrer bewusst sein und sich gegebenenfalls bereithalten.
Nach diesen Erläuterungen wollen wir noch einmal auf den Ablauf der Eiablage zurückkommen. Durchschnittlich fünf bläuliche Eier werden jeden Morgen vom Grünfinkenweibchen in das Nest gelegt. Manche Grünfinkenweibchen legen nur vier Eier, andere sechs Eier. Das Brüten beginnt in der Regel mit dem dritten Ei, aber ich habe schon Vögel beobachtet, die beim Legen des letzten Eis brüteten, andere beim Legen des ersten. Ich persönlich ziehe es vor, die Eier im Nest zu belassen und sie bis zum Ende des Geleges nicht täglich durch Attrappen zu ersetzen. Ich lasse also der Natur ihren Lauf, mit dem Risiko, dass sich die Geburten verschieben. Zwischen dem ersten und dem letzten Jungtier können fünf Tage liegen, und in diesem Fall hat das letzte Jungtier kaum eine Chance zu überleben. Die Lösung besteht dann darin, es in das Nest eines Weibchens mit gleichaltrigen und gleichgroßen Jungen zu setzen oder seine Nahrung mit einer Spritze zu ergänzen.
Zwischen dem 6. und 8. Tag der Brutzeit picke ich die Eier mit einem in der Zoohandlung gekauften Eierpicker. Die befruchteten Eier sind leicht zu erkennen. Man erkennt deutlich die Blutgefäße des Kükens sowie die Luftblase, die sich im Laufe der Tage mit dem Wachstum des Embryos ebenfalls weiterentwickeln wird. Man kann die Herzschläge des Embryos erkennen. Ein klares Ei ist lichtdurchlässig. Ein Embryo, der sich nicht entwickelt oder abgestorben ist, ist durch einen dunklen Punkt in der Mitte des Eies zu erkennen. Ich nutze die Fata Morgana, um das Nest und die Eier mit einem insektiziden Pulver zu bestreuen und das Weibchen und die zukünftigen Jungtiere vor Angriffen der grauen und vor allem der roten Läuse zu bewahren.
Das Grünfinkenweibchen brütet allein, einige Männchen brüten auch, aber sie sind selten. Die Brutdauer beträgt 13 Tage. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 65 % in der Aufzuchtstation. Zwei Tage vor dem Schlupf verändert sich das Aussehen der Eierschalen, sie werden heller und matter. Helle Eier sind glänzend und stumpf. Das Bad ist ständig im Käfig oder in der Voliere anwesend. Wenn die Eier nicht schlüpfen, sollte man vorsichtig sein und sich ein paar Tage Zeit lassen, bevor man die Eier aufschlägt. Es gibt keine festen Regeln für das Brüten. Manche Weibchen brüten ab dem ersten Ei, andere ab dem dritten und wieder andere ab dem letzten. Daher ist es schwierig, den genauen Zeitpunkt des Schlüpfens vorherzusagen, vor allem, wenn man der Natur ihren Lauf lässt.

Wenn die Jungen geschlüpft sind, entfernen die Grünfinkenweibchen, die besonders reinlich sind, die Eierschalen und legen sie weit weg vom Nest. Es ist nicht ungewöhnlich, sie im Futtertrog zu finden. Wenn dies der Fall ist, ist es für den Züchter perfekt, denn er muss sich nicht wundern, wenn die Jungen geboren sind.
Die Ernährung sieht dann wie folgt aus: Übliche Körnermischung, vitaminreiches Trockenfutter, angereichert mit morbiden Perlen, aufgetauten Pinckies und kleinen schwarzen Sonnenblumen, Rispenhirse, frischem Apfel, grauem Perilla und reichlich wilden Gräsern. Die erste Brut fällt mit der Erntezeit von weißem Vogelmiere, Löwenzahn und den ersten Gemüse-Latticharten zusammen.

morbide Perlen, Sprossenpastete


morbide Perlen, Sprossenpastete
Junge Grünfinken in Farbmutationen: einfache und doppelte Verdünnung gelber Schnabel

Junge Grünfinken Braun, Achat und Isabelle

Junge Isabelle satiniert und einfache Verdünnungen
Mit etwa 15 Tagen verlassen die Jungvögel das Nest und beginnen zu fliegen. In den ersten Tagen bleiben sie die meiste Zeit am Boden. Es empfiehlt sich, in der Voliere einen Ast eines Baumes auszulegen, mit dem sie Ast für Ast hochklettern können, um die oberen Sitzstangen zu erreichen. Lassen Sie der Natur ihren Lauf, und Ihre Jungvögel werden bald in der Lage sein, normal zu hocken. In der Zwischenzeit geht das Grünfinkenweibchen auf eine zweite Runde, nachdem es in einem anderen Nistkasten ein neues Nest gebaut hat. Während der Brutzeit wird sie häufig von ihren Jungen gestört, bis diese entwöhnt sind, wenn sie in eine andere Umgebung umgesiedelt werden. Häufig ist zu beobachten, dass die Jungen der ersten Brut das neue Nest besetzen und oftmals zahlreiche Schäden verursachen. Die Eier können zerbrochen sein, ihr Kot verunreinigt die Eier, das Weibchen wird so sehr gestört, dass es die zweite Brut aufgibt… Man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das vorrangige Ziel darin besteht, die erste entwöhnte Brut zu sichern, und nicht 100 % positiven Ergebnissen hinterherlaufen. Die Amateurzucht sollte nicht quantitativ, sondern vorrangig qualitativ betrieben werden. Dies erklärt, warum die zweite Brut oft misslingt. Die dritte Brut fällt mit der Entwöhnung der Jungen zusammen, so dass das Weibchen in Ruhe brüten und aufziehen kann, wenn das Männchen sie in Ruhe lässt. Wenn die Jungen das Nest verlassen, reduziere ich gewöhnlich die wilden Gräser sehr stark und höre auf, gekeimte Samen zu füttern. Andernfalls werden die Jungen nur das fressen, was sie mögen und was leicht zu picken ist, Grünzeug und Samenkeime. Eine solche Diät führt zu Enteritis, schwächt den Organismus der Vögel und erzeugt selbst neue Erkrankungen wie Kokzidiose und vor allem Lankesterelose. Ich füttere immer die gleiche Körnermischung, Trockenfutter, das mit Morbidperlen angereichert ist, und reichlich graue Perillasamen und natürlich täglich frischen Apfel.
Grünfinken können in Aufzuchtkäfigen brüten. Die Grundregel lautet, dass man Zuchttiere haben sollte, die unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen sind. Die größte Schwierigkeit besteht jedoch darin, das Weibchen zum Brüten zu bringen. Das Männchen wird sich, sobald es in Zuchtbedingungen ist, paaren, wenn das Weibchen zur Fortpflanzung bereit ist. Der Züchter muss jedoch wachsam sein, da das Männchen auf engem Raum, wenn es zu aufgeregt ist, das Weibchen stören, das Nest zerstören, die Eier rauben und sogar die Jungen bei der Geburt töten kann. Unter solchen Haltungsbedingungen empfiehlt es sich, das Männchen nach dem Legen des letzten Eis mithilfe eines Trenngitters zu separieren. Auf diese Weise kann das Weibchen das Männchen weiterhin sehen und das Gelege allein aufziehen.
Wenn die Jungen entwöhnt sind, ist es an der Zeit, das Männchen wieder mit dem Weibchen zusammenzubringen. Vorsicht: Wenn Sie so vorgehen, kann es durchaus sein, dass das Weibchen nach 15 Tagen, wenn die Jungen das Nest verlassen, erneut ein Gelege legt. In diesem Fall sollten Sie die unbefruchteten Eier wegwerfen und das Weibchen durch vorübergehendes Entfernen der Nester daran hindern, eine neue Brut zu beginnen. Manche Weibchen hören nämlich ab dem Zeitpunkt, an dem sie wieder zu brüten beginnen, auf, ihre Jungen zu füttern. Da die jungen Grünfinken in diesem Fall ab einem Alter von 30 Tagen entwöhnt werden, müssen Sie sich in Geduld üben. Das Prinzip ist, die erreichten Ergebnisse zu erhalten und zu sichern, bevor man versucht, eine neue Brut zu bekommen.
Manche Männchen sind sofort bereit, die Jungen zu füttern, wenn man das Trenngitter entfernt, andere nicht. Es ist Aufgabe des Züchters, sich darauf einzustellen.
Die Beringung :
Die Beringung ist ein besonders wichtiger Schritt für den Züchter.
Jedes Jahr bringen die Verbände gemäß den Richtlinien des Weltbundes für Vogelkunde Ringe in der Farbe des Jahrgangs auf den Markt. Der geschlossene Ring ist der Personalausweis des Vogels.
Bei der Beringung, die am besten abends gegen 19 Uhr stattfindet, sollten Sie auf das Verhalten des Weibchens achten, mit ihm sprechen, um es zu beruhigen, wenn nötig, und es auf keinen Fall in Panik versetzen. Gehen Sie in langsamen Bewegungen vor.
Die Ringe werden mit einem hautfarbenen Pflaster abgeklebt, um die Farbe des Ringes oder seinen Glanz zu verdecken. Wenn die Jungvögel zu früh beringt werden, wollen die Weibchen aus Sauberkeitsgründen die Ringe ihrer Jungvögel entfernen und werden dabei manchmal so wütend, dass sie ihre Jungvögel verstümmeln und sogar auf den Boden der Voliere werfen. Deshalb ist es wichtig, vorsichtig zu sein und die Beringung zum richtigen Zeitpunkt vorzunehmen. Es ist üblich, zu warten, bis der erste Kot auf den Nesträndern liegen bleibt, was ein Zeichen dafür ist, dass das Weibchen seine Wachsamkeit in Bezug auf die Sauberkeit des Nestes verringert. Das ist ein Indikator, aber wenn die Jungen gut gefüttert werden, ist das Beringen aufgrund ihres Wachstums schwierig oder unmöglich, da die Gefahr besteht, dass sie verletzt werden.

Beringung mit einer Tarnkappe des Rings

Die Beringung muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, nicht zu früh und nicht zu spät…
Wie wird die Beringung durchgeführt?
Die Beringung junger Grünfinken erfolgt am sechsten oder siebten Tag. Das Bein wird mit etwas Speichel befeuchtet. Mit einer Hand hält der Züchter das Bein des Jungvogels fest, während er mit der anderen Hand den geschlossenen Ring überzieht. Die ersten drei Finger werden durchgezogen und gleiten dann über das Gelenk. Der Züchter sollte darauf achten, den Ring zu drehen, indem er sich vorsichtig vorschiebt, das Gelenk massiert und leicht an den ersten drei Fingern zieht. Danach wird der vordere Finger durchgesteckt und der Züchter muss den Ring hochziehen, um ihn schnell zu lösen. Anschließend wird der Ring wieder an der Pfote heruntergezogen und zum Schluss werden die Finger bewegt, um zu überprüfen, ob das Gelenk einwandfrei funktioniert. Damit der letzte Schritt leichter gelingt, kann man sehr vorsichtig einen Zahnstocher benutzen, um den Ring über den letzten Finger zu schieben.
![]()
Um die Risiken zu begrenzen Zusammenfassung einiger Empfehlungen:
- Beringung erst, wenn das Weibchen das Nest nicht mehr perfekt reinigt.
- Beringen Sie am besten abends gegen 19 Uhr. Das Weibchen vergisst in der Nacht die Störung durch die Beringung.
- Tarne den Ring mit einem hautfarbenen Pflaster. Das Ziel ist es, den Glanz des Ringes zu verdecken. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Ringe mit einem dünnen, hautfarbenen, plastifizierten Pflaster abgedeckt werden.
Einige Züchter verwenden für diesen Vorgang Rauchschwarz oder schwarzen Filz. Nachdem ich verschiedene Methoden zum Abdecken getestet habe, bin ich der Meinung, dass die besten Ergebnisse mit dem Pflaster erzielt werden.
Der Durchmesser des Rings :
Er muss unbedingt der Art oder Unterart entsprechen, die man züchtet. Man beringt einen Grünfinken der Unterart Auriventris nicht mit demselben Ring wie einen Malteser-Grünfinken. Beringe niemals mit einem zu kleinen Durchmesser. Ich empfehle Ringe mit einem Durchmesser von 2,9 mm bis 3,2 mm.
Unfälle bei der Beringung :
- Das Weibchen beringt ihre Jungen. Wenn das Weibchen den Ring von der Pfote ihres Jungtiers entfernen will, zieht es am Ring und dreht den unteren Finger um. Das Bein weist dann eine schwere Deformation auf, da der verletzte Finger die Sitzstange nicht mehr greifen kann und der Vogel sein Bein auf dem geknickten Finger ablegt, was die Verletzung noch verstärkt. In diesem Fall muss der Fuß des Jungvogels sehr schnell umtrainiert werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der deformierte Finger mit einem Pflasterstreifen oder einem Zellulosering hochgehalten wird. Im Laufe der Zeit wird sich das Pflaster lockern und der Finger wieder eine normale Position einnehmen. Diese Lösung wurde in meiner Zucht mehrfach erfolgreich erprobt. Bei einigen Jungtieren funktioniert die Pfote wieder normal und es sind keine Deformationen mehr zu sehen. Andere behalten eine Versteifung des unteren Fingers, die sie von Ausstellungen, aber nicht von der Zucht fernhalten wird.

Finger nach Beringung durch die Mutter zurückgegeben

Korrektur der Fingerpositionierung und Platzierung des Pflasters

So kann der Jungvogel sein Bein auf der Sitzstange normal positionieren und die Umerziehung selbst durchführen.
- Junge, die aus dem Nest geworfen werden. Seltene Unfälle bei Grünfinken. Häufiger bei Braunkehlchen und Gimpel. Die Lösung: Die Jungvögel nicht zu früh beringen und vor allem den Glanz des Ringes gut tarnen. Man sollte die Jungvögel wieder ins Nest setzen und beobachten. Wenn das Weibchen oder das Männchen es wieder versuchen, besteht Plan B darin, eine Adoptivmutter zu finden.
- Ring mit zu geringem Durchmesser. Dieser schwerwiegende Fehler wird durch Unkenntnis der Unterart und des passenden Ringdurchmessers verursacht. Die Lösung ist ein schnelles Abschneiden des Rings mit einer speziellen Schere aus dem Zoofachhandel. Achtung: Ein geräumter Vogel, der unter die Vorschriften fällt, muss von einer offiziellen, befugten Stelle mit einem offenen Ring beringt werden, den man nach dem Anbringen aufklebt, indem man die beiden Enden zusammenfügt.
Entwöhnung der Jungvögel
Die Entwöhnung ist DIE sensible und risikoreiche Zeit für den Züchter und vor allem für die jungen Grünfinken. Nach etwa 30 Tagen fressen die Jungvögel selbstständig. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn die Voliere groß ist, kann man sich dafür entscheiden, die Jungvögel in der Brutvoliere zu belassen. Sie werden weiterhin von ihren Eltern gefüttert, während ihre Mutter die zweite Brut aufzieht. Auf diese Weise zu funktionieren, bietet einen gewissen Komfort, aber auch einige Unannehmlichkeiten. Denn wenn Sie die Jungvögel vorbeugend behandeln, müssen Sie zwangsläufig auch die Elterntiere mitbehandeln.
Am besten ist es, die entwöhnten Jungvögel in einer anderen Voliere unterzubringen, die nur für die Jungvögel des Jahres bestimmt ist. Das Futter ist trocken und besteht aus der üblichen Mischung, vitaminisiertem Trockenfutter, ergänzt durch morbide Perlen und ein wenig kleine schwarze Sonnenblumenkerne, frische Äpfel und Rispenhirse. Zwischen dem 30° und dem 60° Tag besteht die Gefahr eines schnellen Todes. Der Vogel scheint am Morgen in guter Verfassung zu sein, obwohl er bereits infiziert und abgemagert ist, sein Gefieder mittags aufzuplustern beginnt und am Ende des Tages auf dem Boden der Voliere ruht. Man denkt dann an Kokzidiose, vor allem aber an Lankesterelose. Um sie zu schützen, erhalten die Jungtiere im Trinkwasser eine Behandlung mit Sulphadimetoxin. Dieses Molekül erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt. Man kann auch natürliche Kräutertees auf Thymianbasis verwenden. Ich persönlich habe mich seit mehreren Jahren für die erste Lösung entschieden, um möglichen Erkrankungen vorzubeugen. Die oben beschriebenen Symptome sind die, die die alten Züchter als „Grünfinkenkrankheit“ bezeichneten, die auch die Jungtiere des Jahres während der Jugendmauser befällt. Damals starben 50-70% der Jungtiere bei der Entwöhnung oder während der Mauser. Heute ist dieses Risiko begrenzt, sofern eine vorbeugende Behandlung durchgeführt wird.

Der Haarwechsel
Die Mauser der Jungvögel findet zwischen dem zweiten und dritten Monat statt. Anfang August fallen auch bei den Altvögeln die ersten Remiges und Retrices nach und nach ab, die Mauser beginnt und endet Mitte September. Es ist sinnvoll, den Vögeln in dieser Zeit einen Polyvitaminkomplex zu verabreichen. Dieser Teil des Jahres ist sicherlich der schwierigste für die Vögel aller Arten und auch der beängstigendste für den Züchter. Die Anstrengungen einer Saison können innerhalb weniger Tage zunichte gemacht werden, wenn der Herbst naht. Es ist zu beobachten, dass unreife Jungtiere während der Mauser am anfälligsten für Probleme sind. Man darf nicht vergessen, dass sie ihr Gefieder innerhalb weniger Monate zweimal aufbauen müssen. Normalerweise verlieren die Jungvögel bei der ersten Mauser nicht die ersten Federkiele und die ersten Steuerfedern, da dies die Ermüdung des Körpers nachahmt. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und in manchen Jahren verlieren junge Grünfinken je nach Wetter und Hitze ihr gesamtes Gefieder. Es wird empfohlen, sie in dieser Zeit nicht zu bewegen und keinem Luftzug auszusetzen. Der durch den Umgebungswechsel verursachte Stress wird ihre allgemeine Anfälligkeit erhöhen. Es ist ratsam, die Jungvögel in ihrer Absetzvoliere zu belassen, bis die Mauser vollständig abgeschlossen ist. Wenn ein Vogel beginnt, sein Gefieder aufzuplustern, einen ebenfalls aufgeplusterten Bauch zeigt, traurig dreinschaut, die Augen schließt oder sogar tagsüber schläft, ist die Katastrophe nahe. In diesem Fall muss man sehr schnell reagieren, den kranken Vogel in einen 30 °C warmen Krankenhauskäfig setzen und ihm 5 bis 7 Tage lang eine Behandlung gegen Kokzidien verabreichen. Anschließend reboostert man ihn, indem man seine Darmflora mit Ultrahefe, dann mit Vitaminen und Spurenelementen wieder aufbaut. Bei Jungvögeln und seltener bei erwachsenen Vögeln kann man auch einen Mauserstopp beobachten. Bei Jungvögeln erscheinen ein oder zwei neue farbige Federn im Brustbereich, und die Mauser scheint zu stocken. Dieser Prozess, den ich als Mauserblockierung bezeichne, ist sehr oft tödlich. Eine gut verlaufende Mauser beginnt symmetrisch an den Flanken und endet am Kopf.
HAUPTSCHWIERIGKEITEN BEI DIESER ART VON ZUCHT – –
Aggressivität einiger Männchen, das Männchen sticht die Eier oder frisst sie:
Verschiedene Techniken: Das Männchen trennen und in einem Ausstellungskäfig belassen, ein unangenehmes, nicht schädliches Produkt in helle Eier injizieren und diese in das Nest legen. Manche verwenden ein Produkt auf Chili-Basis.
Vom Weibchen gefressene Eier (ohne Lösung!): Weibchen ungeeignet für die Fortpflanzung. Nun, wenn der Vogel für Ihre Zucht besonders wichtig ist: Schönheit, großes genetisches Kapital, seltene Mutation… bleibt noch die Technik, unangenehme Produkte in Eier zu injizieren, die man in das Nest legt. Und wenn Sie Zeit haben, greifen Sie ein, sobald das Weibchen ein Ei gelegt hat, um das Ei zu retten und es einem Ersatzweibchen anzuvertrauen.
Tod von Embryonen während der Inkubation um den 7. Tag herum: Anfälligkeit der Embryonen bei Mutationen. Bakterien, die durch den Kot des Muttertiers in das Ei übertragen werden. Im zweiten Fall kann eine gründliche Untersuchung mit Antibiogramm erforderlich sein.
Mortalität im Ei kurz vor dem Schlüpfen: möglich bei starker Trockenheit und daher geringer Luftfeuchtigkeit.
Tod von Jungmutanten bei der Geburt (Anfälligkeit von Küken mit Farbmutationen),
Schwierige Entwöhnung, wenn das Männchen nicht füttert, während das Weibchen wieder brütet.
Anfälligkeit der Jungvögel im ersten Winter, wenn dieser besonders feucht ist.